Die Hygiene in der Patientenumgebung spielt eine entscheidende Rolle bei nosokomialen Infektionen sowie postoperativen Wundinfektionen (SSI). Um das Kontaminationsrisiko zu verringern, ist es sinnvoll, dass das Fachpersonal einen standardisierten Reinigungs- und Desinfektionsplan befolgt. Eine effektive und dennoch zeiteffiziente Reinigung der Umgebung erfordert die Identifizierung von berührungsintensiven und patientennahen Oberflächen, da diese für die Risikoeinschätzung einer Erregerübertragung höchst relevant sind. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt unterschiedliche Maßnahmen zur Oberflächenreinigung und -desinfektion basierend auf der Häufigkeit des Hand- und Hautkontakts:
Bereiche ohne Infektionsrisiko | Bereiche mit einem potentiellen Infektionsrisiko | Besonders infektionsgefährdete Bereiche | Bereiche mit infektiösen Patienten |
|---|---|---|---|
Treppenhäuser, Flure, Büros, Speisesäle, Vorlesungsräume, Klassenzimmer, technische Bereiche | Stationen, Ambulanzen, Radiologie, Physiotherapie, Erste-Hilfe-Räume, Dialyse, Intensivpflege | OP-Abteilungen, spezielle Intensivpflege, Transplantationsabteilungen, onkologische Abteilungen | Isolierbereiche oder abgetrennte Funktionsbereiche, in denen diese Patienten behandelt werden |
Alle Oberflächen sind gründlich zu reinigen. Eine regelmäßige Oberflächen- desinfektion ist nicht nötig. | Eine regelmäßige Desinfektion von Oberflächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt wird empfohlen. Fußböden und andere Flächen sollten gereinigt werden. | Eine regelmäßige Desinfektion von Oberflächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt und der Fußböden wird empfohlen. Andere Flächen sollten gereinigt werden. | Eine regelmäßige Desinfektion von Oberflächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt und der Fußböden wird empfohlen. Andere Flächen sollten gereinigt werden. |
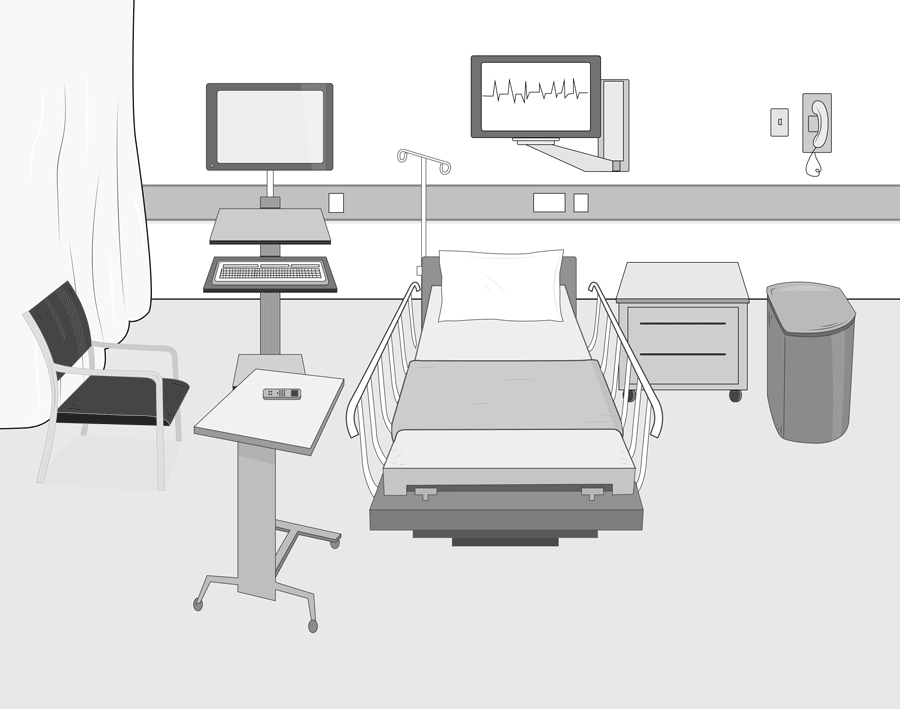
Quelle: KRINKO: Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI). Bundesgesundheitsbl. 2004; 47: 51–61